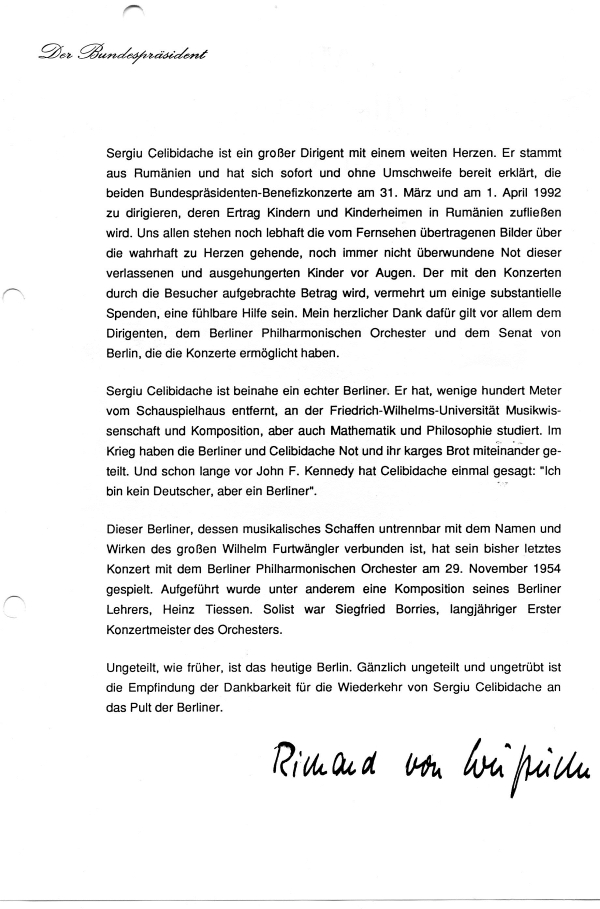Im Spiegel der Medien...
Celibidaches Rückkehr...
Nach
37 Jahren (April 1992): Celibidache wieder am Pult
der Berliner Philharmoniker:
Klaus Geitel: Ein Spätheimkehrer an der
Spree
Wolfgang Sandner: Die
Heimkehr des verlorenen Vaters
Eckard Schwinger: Bewegende und beglückende Begegnung
Frieder Reinighaus: Gelassen und Triumphal
Albrecht Roeseler: Triumphale Rückkehr eines Verwandelten
Hellmut Kotschenreuter: Ein Eidbruch wird zum
Ereignis
Sybill Mahlke: Der triumphierende Heimkehrer
Darauf hatte das
Musik-Berlin jahrzehntelang gewartet: die Rückkehr
Sergiu Celibidaches ans philharmonische Pult, an
dem er am 29. August 1945, Berlin lag in Schutt
und Asche, seine erratische Karriere begann. 414mal
hat Celibidache das Berliner Philharmonische Orchester,
das ihm in den schwersten Zeiten der hundertzehnjährigen
Orchestergeschichte unendlich viel zu verdanken
hat und dem er selbst unendlich vieles verdankt,
im Laufe der frühen Nachkriegsjahre dirigiert. Bis
er nun auf Einladung des Bundespräsidenten zum 415.
Mal vor seinem alten Orchester stand, mussten 37
Jahre vergehen; eine unerklärliche, eine unverständliche
Pause. Nun aber ist der letzte Mauerrest in Berlin
gefallen; jener, der das Berliner Philharmonische
Orchester von Celibidache trennte. In zwei Benefizkonzerten
zugunsten rumänischer Kinderheime dirigierte er
Bruckners siebte Sinfonie.
Für die Aufführung der E-Dur-Sinfonie benötigte Karajan rund 65 Minuten, Giulini 67, Chailly und Jochum 69, Maazel 74 Minuten. Celibidache dagegen forderte für seinen ebenso gewaltigen wie gemessenen Vortrag des Stückes etwas über anderthalb Stunden. Was unter seinen Händen erklang, war, leicht nachprüfbar, zweifellos dieselbe Musik; aber, Wunder über Wunder, keinen Takt lang die gleiche.
Sechs Proben hatte Celibidache gefordert - und bekommen; ein Zeitaufwand, zu dem sich die Philharmoniker sonst nicht gern hinreißen lassen - und schon gar nicht bei einem ihnen angeblich längst in Fleisch und Blut sitzenden Stück. Celibidache aber machte den Musikern deutlich, dass Fleisch nicht einzig Sitzfleisch bedeutet und Blut nach wie vor ein ganz besonderer Saft ist. Dirigieren heißt für ihn nichts anderes als musikalische Aufklärungsarbeit leisten. Dazu braucht es innere Zuwendung, Muße, Versenkung, Erleuchtung. Celibidache wies im Grunde einzig nach, dass die Zeit der Durchreise-Auguste am Dirigentenpult längst vorbei ist.
Auch die Philharmoniker, eingesponnen in ihr Netz aus kommerziellen Verpflichtungen, empfanden das wohl und vielleicht seit langem wieder zum ersten Mal. Sie baten Celibidache nach einer Probe zu einem Gespräch über Musik, zu dem sich an die vierzig Musiker einstellten, ein gutes Drittel des Orchesters also. Und anderthalb Stunden lang ging der Dialog hin und her. Er mündete in den Wunsch, Celibidache regelmäßig jede Spielzeit am philharmonischen Pult in Berlin wiederzusehen; in der Bitte, dem Orchester nach Möglichkeit eine ganze Arbeitswoche unter seiner Leitung einzuräumen. Selbst zu einer aufklärerischen Wallfahrt nach München, wenn Celibidache dort mit ihnen arbeiten könnte, sahen sich viele gedrängt. Die Harmonie zwischen dem Orchester und dem Maestro war vollkommen, und sie übertrug sich auf das Konzert. Es wurde in Andachtshaltung gespielt. Es wurde in Andachtshaltung empfangen.
Der Bundespräsident hatte in einigen, das Konzert einleitenden Worten bereits von Celibidaches "bewunderungswürdiger Integrität" gesprochen, und die ging nun voll in den wahrhaft altmeisterlichen Vortrag der Sinfonie unter Celibidache ein. Auf seinem Dreifuß saß er da wie eine weise, weißhaarige, aufs Konzertpodium verschlagene männliche Pythia, hineinhorchend in die Abgründe der Musik und sie in klaren, ruhigen, deutlichen Zeichen beschreibend.
Das Orchester folgte ihnen mit Aufmerksamkeit, Hingabe, in aller erdenklichen Schönheit. Wie ein bloßer Verdacht auf Musik, im äußersten Pianissimo der sirrenden hohen Streicher, hob die Sinfonie an. Immer wieder wurden die kontrapunktischen Künste Bruckners mit Sorgfalt und Bedacht, geradezu wie auf des Messers Schneide, ausgestellt. Kein Musikrausch wurde entfesselt. In äußerstem Moderato entfaltete sich das Allegro, das sich insgesamt dann eher in einem sehr getragenen Andante entwickelte. Doch Furchtlosigkeit vor der Gefahr, Langeweile zu säen, zeichnet Celibidaches unverwechselbare Kunst seit langem schon aus.
Sehr langsam werden die Steigerungen angegangen und aufgebaut. Das schwere Blech wächst auf diese Weise den Höhepunkten entgegen, ohne je brüllfreudig loszudonnern. Celibidache gibt dem Klang volle Majestät, ebenso wie er, zumal im ungeheuren Adagio, das Gefühl ausmusizierter Ewigkeit aufkommen lässt. Die gemessenen, im Trauerschritt vorbeiziehenden Fortschreitungen geben überdies den Orchestersolisten wundervolle Gelegenheit, sich zu artikulieren. Nie allerdings haben Celibidaches musikalische Ansichten ähnlich zu überzeugen verstanden wie jetzt am Pult seines alten Orchesters, in dem freilich nur die wenigsten je zuvor unter seiner Leitung gespielt haben dürften. Es ist schon traurig und bedenklich, dass ein Mann seines Kalibers dem zweifellos bedeutendsten Orchester Deutschlands erst jetzt zurückgekehrt ist.
Am Schluss ein vorwitzig schnelles Bravo, durchaus fehl am Platz. Danach wieder Stille. Ein Mini-Applaus; auch er wieder verstummend. Dann endlich löste sich die Spannung zu unendlichem Jubel und Dank, den Philharmonikern und dem Mann an ihrer Spitze aus vollem Herzen aufs ehrlichste dargebracht: Sergiu Celibidache, dem musikalischen Spätheimkehrer.
KLAUS GEITEL - Die Welt
Die
Heimkehr des verlorenen Vaters
Sergiu
Celibidache dirigiert nach achtunddreißig Jahren
wieder die Berliner Philharmoniker
Musikalische Sternstunden ereignen sich nicht nur, sie werden auch gemacht. Wer Sergiu Celibidache nach fast vier Jahrzehnten wieder ans Pult der Berliner Philharmoniker holt, an das Orchester, das den jungen Rumänen nach dem Tod Wilhelm Furtwänglers im. Jahre 1954 ungerechterweise nicht Zum Chefdirigenten auf Lebenszeit kürte, vielmehr einen anderen Emporkömmling vorzog, der hat die Stunde der Kunst programmiert. Richard von Weizsäcker ist es zu verdanken, daß man vielleicht ein letztes Mal spekulieren darf. Nach dem Benefizkonzert des Bundespräsidenten zugunsten der Rumänienhilfe, bei dem im Berliner Schauspielhaus jetzt die Philharmoniker und der Eigenbrötler unter den großen alten Dirigenten der Gegenwart wiedervereint wurden, fragt man sich, was wohl geworden wäre, hätte nicht der smarte Karajan, sondern der widerborstige Celibidache seinerzeit das deutsche Renommierensemble übernommen.
Möglicherweise wäre der Katalog von Aufnahmen mit den Berliner Philharmonikern schmaler, die Physiognomie des Orchesters scharfkantiger, der Aktionsradius der Musiker begrenzter, als dies heute der Fall ist. Aber das musikalische Sprachrohr der Frankfurter Schule, Theodor Adorno, hatte wohl recht mit der Behauptung, kein Orchester könne so falsch spielen, wie ein Dirigent falsch zu schlagen vermöge. Will sagen: Die Macht des Dirigenten wird häufig über-, die des Orchesters unter- schätzt. Sicherlich hätte sich ein nicht frustrierter Sergiu Celibidache als Chef eines der bedeutendsten Sinfonieorchesters der Welt - in einer Zeit, in der die Klänge sich wie Stammestrommeln eines globalen Dorfes unaufhörlich auszubreiten begannen - auch anders entwickelt, als in der relativen Abgeschiedenheit der musikalischen Provinz. Zum künstlerischen Anachoreten wird man leichter an der Peripherie der musikalischen Entwicklung.
Wer beeinflußt wen? Das traditionsreiche Orchester eines musikalischen Zentrums einen talentierten Dirigenten oder das individuelle Künstlergenie einen schönen und gefügigen Klangkörper? Claude Debussy hat dazu die Antwort gefunden: Als Gott Pan die sieben Rohrpfeifen der Syrinx zusammenband, ahmte er zunächst nur den langen melancholischen Ton nach, den die Kröte klagend zum Mondlicht schickt. Später trat er in Wettstreit mit dem Gesang der Vögel. Wahrscheinlich haben die Vögel seit jener Zeit ihr Repertoire erweitert.
Zu Sternstunden gehörte Suggestion, Das war auch im akustisch ausgezeichneten Berliner Schauspielhaus, am Gendarmenmarkt spürbar, als Richard von Weizsäcker den großen und weisen' Dirigenten am Pult seines Orchesters begrüßte. Die Berliner Musiker sind zu intelligent, im jahrelangen Kampf mit Karajan schließlich auch zu selbständig geworden, als daß sie in Gefahr gewesen wären, die Zusammenkunft mit ihrem Chefdirigenten aus der Interimszeit von 1946 bis 1952 nach so vielen Jahren als sentimentale Geste der Wiedergutmachung zu zelebrieren. Als Heimkehr des verlorenen Vaters mag das Ereignis mehr dem respektvollen Publikum erschienen sein, dem nach einer gigantisch gedehnten siebten Sinfonie von Anton Bruckner buchstäblich der Applaus in den Fingern stecken blieb, bis ein generöser Celibidache sozusagen mit, einem Wink den Weg zu frenetischen Ovationen freigab. Aber daß sich das Orchester auf der Basis weniger Proben so vollendet dem Willen Celibidaches anpaßte, so konzentriert und sensibel reagierte, hängt sicher auch mit dem Bewußtsein jedes einzelnen Musikers zusammen, ein außergewöhnliches kulturpolitisches Ereignis musikalisch entsprechend stützen zu wollen.
Wer die Partitur von Bruckners siebter Sinfonie nicht in Händen hielt, der mag sich verwundert gefragt haben, wo die Noten hergekommen sein mögen, die Musiker in den gut und gerne zwanzig Minuten gespielt haben, die das Werk länger als in Interpretationen anderer Dirigenten gedauert hat. Die Zweifler können beruhigt werden. Auch Sergiu Celibidache, der wie viele seiner Kollegen in jüngeren Jahren selbst Komponist gewesen ist, hat dem Werk nichts hinzugefügt. Aber so wie Celibidache hat noch kein Dirigent Bruckners Anweisungen zum ruhigen, sehr feierlichen und sehr langsamen Ausmusizieren dieser im Todesjahr Richard Wagners entstandenen, trotz der Tonart E-Dur von düsteren Klangmassierungen durchdrungenen Sinfonie ernstgenommen. Und nur mit den auf seine himmlischen Längen ein geschworenen Münchener Philharmonikern oder eben mit einem Ausnahmeorchester wie den Berliner Philharmonikern sind solche musikalischen Zerreißproben möglich, die nicht in der Auflösung der kompositorischen Struktur enden, sondern in einer geradezu körperlich erfahre baren musikalischen Spannung. Wagner hat das Prinzip der unendlichen Melodie geschaffen, Bruckner hat es in eine sinfonisch konsequente Architektur übertragen, aber erst Celibidache hat sozusagen den Blick auf die ganze Schönheit dieser Konstruktion eröffnet, bei der jeder Ton den anderen stützt und zugleich melodisch funkelt: Lebendige Schönheit der Musik, die nicht auf ein Rechenexempel reduziert werden kann, bei dem zwei mal zwei genau vier ergibt. Und erst im Zeitlupentempo Celibidaches werden solche harmonischen Kraftakte wie die Trugschlußkadenz im Adagio zu nahezu schmerzlich fühlbaren musikalischen Höhepunkten.
Was Brahms an Bruckner kritisierte, die Verschleierung der thematischen Arbeit und des variativen Klangs durch die schier unendliche Melodie, das wird bei Sergiu Celibidache und den Berliner Philharmonikern wieder aufgehoben; vor allem auch deshalb, weil das Orchester die minimalen Regungen des im Sitzen dirigierenden Celibidache in klangliche Details umzusetzen vermag, ohne sich darin zu verlieren. Stets hatte man das Gefühl, nicht nur der Dirigent, sondern auch die einzelnen Orchestermitglieder hörten den Ton und seine Folgen.
Es mag ebenso auf die Akustik des Saales im Berliner Schauspielhaus zurückzuführen sein, daß die kompositorischen Nervenstränge des Orchestersatzes so offen liegen. Sicherlich aber hängt die strukturelle Klarheit auch mit zwei Faktoren des instrumentalen Spiels zusammen. Die einzelnen Ensembles der Berliner Philharmoniker -Streichersatz, Blech- und Holzbläser, aber auch die einzelnen Gruppierungen innerhalb dieser Sektionen - verhalten sich sozusagen autark zueinander, als seien es Stimmen in einem polyphonen Gefüge von, Johann Sebastian Bach: Dissonantreibungen werden so nicht durch eine Führungsstimme geglättet, sondern betont. Zudem neigen die hohen Streicher zu einem eher unpathetischen, unkonzilianten Ton, die Holzbläser - möglicherweise unfreiwillig - zu gewissen Klangschärfen. Der Effekt dieses jegliche Larmoyanz, jegliches Pathos meidenden Orchestersprache aber ist nicht etwa ein neutraler, kalter Gesamtklang, vielmehr ein Trauergestus von ungeheuerer lakonischer Wucht. Möglicherweise lag es auch an daran, daß es dem Publikum am Ende des Konzerts zunächst den Applaus verschlug. Jedenfalls meint man, die Berliner Philharmoniker mit ihren wunderbaren Blechbläsern kaum je so überzeugend, so über jeden musikalischen Zweifel erhaben gehört zu haben. Mag sein, daß dies auch mit Suggestion zu tun hat. Aber selbst dafür muß man dem Berliner Philharmonischen Orchester und seinem grandiosen Dirigenten Sergiu Celibidache in dieser Stunde dankbar sein.
Wolfgang Sandner - Frankfurter Allgemeine Zeitung
Bewegende
und beglückende Begegnung
Sergiu
Celibidache dirigierte Benefizkonzert der Berliner
Philharmoniker
Bereits vor fünf Jahren, als der in Berlin zu ersten dirigentischen Ehren herangewachsene, inzwischen legendäre rumänische Weltklassedirigent mit den Münchner Philharmonikern im Schauspielhaus Bruckners "Achte" zur Aufführung gebracht hatte, wagte zunächst niemand die Hände zu rühren, so tief saß die Erschütterung nach der unerhörten, urgewaltige Dimensionen aufreißenden Wiedergabe. Erst nach langem Schweigen brach ein Orkan aus. Diesmal, an dem denkwürdigen Tag für den Dirigenten, das Orchester, die Musikstadt Berlin, war alles anders, setzte der Beifallssturm gleich beim ersten Erscheinen des Neunundsiebzigjährigen ein, als er erstmals nach achtunddreißig Jahren am Pult des Berliner Philharmonischen Orchesters erschien, um dieses außergewöhnliche Konzert, dieses Benefizkonzert des Bundespräsidenten zugunsten von Kinderheimen in Rumänien, zu leiten. Auf eine Bitte Richard von Weizsäckers hatte sich Sergiu Celibidache erst bereit erklärt, nach bald vierzig Jahren sein altes Orchester wieder zu dirigieren, das er eigentlich aufgrund unglückseliger Konstellationen nach seiner Chefdirigentenzeit in den Jahren 1945 bis 1952 nicht wieder leiten wollte. Und nun ereignet sich doch der von niemandem mehr für möglich gehaltene große Augenblick der Wiederbegegnung! Der Bundespräsident hatte ihn zuvor aufs herzlichste begrüßt und daran erinnert, das Sergiu Celibidache beinahe ein echter Berliner sei und schon lange vor Kennedy einmal gesagt habe: "Ich bin kein Deutscher, aber ein Berliner."
Vermutlich lag über kaum einem Konzert eine solch hohe Erwartung, eine solch hohe Spannung und Vorfreude. Die Spannung war immens, und sie entlud sich in frenetischem Jubel nach der "Siebenten" von Bruckner, der Celibidache, nun auch vor den Philharmonikern wie ein Patriarch stehend, gebieterisch und glückstrahlend zugleich, eine von epischer Weite, Tiefe und Wucht getragene Interpretation zuteil werden ließ. Sicherlich wird niemand behaupten wollen, daß "Celi" und die Philharmoniker (nur sechs waren überhaupt noch vom alten Stamm dabei!) so ohne weiteres wieder dort begonnen haben, wo sie sich vor bald vierzig Jahren auf schmerzliche Weise getrennt haben. Denn es hat auch künstlerisch auf beiden Seiten keinen Stillstand gegeben, aber die letztlich alles in Bewegung haltende Musik macht eben nicht nur einen versöhnlichen Brückenschlag möglich, sie überbrückt auch die lange Zeit des nicht Miteinandermusizierens, so daß man schließlich doch meinte, es habe gar keine Unterbrechung in den Beziehungen gegeben. Das plötzlich Wiederzueinanderfinden war beeindruckend, beflügelte alle und riß schließlich auch die Hörer unmittelbar in den weitgestaffelten interpretatorischen Prozeß hinein, so daß es ein Höchstmaß an frohstimmendem Einverständnis, an tief berührendem Miterleben gab.
Bei aller äußerlichen Ruhe, aller erhabenen Gestik und empfindsamen Klangregie verströmt Celibidache nach wie vor einen feurigen Atem, ein großartiges, bisweilen fast stilles und wohl gerade deshalb so gewaltiges Gestaltungsvermögen, eine starke denkerische Aktivität und betont philosophische Werksicht, die viel Zeit in Anspruch nimmt, etwa bei diesem Bruckner - sage und schreibe zwanzig Minuten mehr, als üblicherweise gewohnt ist. Aber das Werk wird dadurch nicht länger, sondern reicher und spannender! Wie spannungsvoll leise beginnt der erste Satz, gleichsam aus den Urtiefen der Musik aufsteigend und sich schließlich zu grandioser, nachgerade raumsprengender Klangarchitektur wölbend. Ein mystisch-verschleierter, weltferner Bruckner war das freilich ganz und gar nicht! Vieles blätterte Celibidache fast heiter, geistvoll vergnüglich auf, wobei freilich selbst nach sechs Proben der schwerelos leichte, fast südländisch belkantistische Ton, den Celibidache nach immerhin dreizehnjährigem Training mit den Münchner Philharmonikern bei Bruckner erzielt (wie die "Achte" im Schauspielhaus bewies), den Berlinern am ersten Abend noch nicht restlos gelingen wollte. Da fesselte vor allem die kraftvolle scharfkonturierte Klangschönheit, die orgelnde Intensität, der kolossale Sound.
Dessen ungeachtet ging Celibidache auch an diesem unvergeßlichen Abend mit der ruhigen Souveränität und uneingeschränkten Fähigkeit der großen Dirigentenpersönlichkeiten zu Werke, die eine solch populäre Sinfonie wie die siebente in E-Dur von Anton Bruckner so sehr von Grund auf neu zu durchdenken, neu zu durchleben und zu durchleuchten wissen, daß man glaubt, sie erklinge zum ersten Male. Da wirkt dieser Bruckner wie ein überraschend modernes Wunderwerk, in dem alles mit letzter, logischer Konsequenz und strukturerhellender Klarheit ausgebreitet, zusammengefügt und die Steigerungen und Überhöhungen mit furtwängerlischer Spannung aufgeladen werden. Und auch das in Erwartung des Todes von Richard Wagner geschriebene Adagio gewann eine ergreifende Größe und abgeklärte, poetische Schönheit, die nicht minder daran erinnerte, wie zu Furtwänglers Zeiten, zu denen eben Celibidache in Berlin war, musiziert wurde. Diese Tradition droht im Konzertalltag, der von geschäftigen Aufnahme- und Reiseterminen bestimmt wird, immer mehr unterzugehen. Celibidache ließ sie wieder anklingen. Und dafür haben ihm nicht zuletzt die älteren Berliner zugejubelt. Mindestens einmal im Jahr müßte er mit dem Philharmonikern musizieren. Wir wüßten's zu schätzen.
Eckart Schwinger
Gelassen
und triumphal
Celibidaches
Rückkehr zu den Berliner Philharmonikern
Gemächlich schob sich der Dirigent in den Vordergrund, noch während der Bundespräsident eine Ansprache an die Gäste seines Benefizkonzertes zugunsten rumänischer Kindergärten im Berliner Schauspielhaus richtete. Was noch zur 750-Jahr-Feier Berlins von den Berliner Philharmonikern kategorisch abgelehnt worden war, wurde durch die Diplomatie des Bonner Präsidialbüros und den Hauptstadt-Sog möglich: Nach fast vier Jahrzehnten kehrte Sergiu Celibidache an das Dirigentenpult des Renommier-Orchesters zurück.
Das Publikum begrüßte es. Empfing den Münchener GeneraImusikdirektor mit besonders herzlichem Beifall, der sich nach getaner Arbeit zur stürmischen Ovation für die einzelnen Gruppen des Orchesters, den Maestro, das Ganze steigerte. Richard von Weizsäcker hatte die Stimmung angekurbelt, als er den "großen und weisen Dirigenten" ankündigte, der schon in seiner Studienzeit ein Berliner geworden sei, von 1945 bis zur Rückkehr Wilhelm Furtwänglers viel zum Wiederaufbau des Orchesters beigetragen habe. Umringt von den Philharmonikern habe er das Gefühl, meinte der Bundespräsident, im Zentrum der Welt zu sein".
Zum letzten Mal hatte Celibidache einen Tag vor Furtwänglers Tod am Nervenpunkt der Berliner Philharmoniker gestanden. Die waren der grüblerischen, metaphysisch inspirierten Interpretationen überdrüssig und setzten - mit Karajan - auf Technokratie. Eine Kapelle wie die, vor der Celibidache nun wieder seine Zeichen in Luft und Boden schrieb, kommt ohne Routine gewiß nicht aus; doch sechs lange Proben dienten jetzt dazu, daß sich der 79jährige Meister und die streichenden bzw. blasenden Großverdiener akkomodieren konnten.
Ein triumphales Comeback mit Bruckners E-Dur-Symphonie. Die Blöcke des thematischen Materials und seiner Fortspinnungen formten sich unter Celibidaches Händen behutsam, zeigten dann in großer Spannung und mit jäher Kraft ihre schärferen Konturen. Die VII. Symphonie bedeutete einst den "Durchbruch" Anton Bruckners auf dem internationalen Markt. Nicht nur von ihren Dimensionen her war sie eine "Pièce de résistance": der flott servierte Hauptgang in einem insgesamt schleppend daherkommenden Lebenswerk. Celibidache versteht noch immer, die bunten Farben der weithin narrativ wirkenden Bruckner-Musik freisetzen zu lassen: das Grelle des massierten Blechapparats, die folkloristisch angehauchten Violinmelodien den zarten Kitsch der Holzbläser. Das Anti-Rationalistische an Bruckners sinfonischen Konglomoraten irritierte manchen Zeitgenossen; aus ihm kommt der Ton, der bis heute die tieferen Zonen der Menschen anspricht.
Auf die aber zielt auch Celibidaches Bedächtigkeit. Das "Sehr feierlich und sehr langsam" trieb Celibidache bis zu jener Grenze, mit der es nicht mehr feierlich, sondern nur noch schleppend wirkt - doch die Gratwanderung gelang als ein versuchtes Äußerstes. Allein für die beiden ersten Sätze der Symphonie nahm der Maestro sich und uns eine volle Stunde. Ob die Inbrunst aus dem Glauben kommt, mag dahingestellt bleiben - doch inbrünstig gelang so manche Episode. Die Gelassenheit des Gesamtverlaufs ließ auch die Zuhörer ruhiger atmen. Und manchem mag gewesen sein, als werde da mit über hundert Zungen eine alte Geschichte erzählt, deren Sinn dunkel bleibt, deren Sprache aber in Bann zieht: wie eine kostbare Antiquität aus "einer dem Untergang geweihten Welt" (Max Kalbeck). Beim Adagio konnte einen der Wunsch beschleichen, daß es nie ende und man nicht wieder zurück in den Alltag entlassen werde.
Mit dem Rumänien-Benefiz-Konzert ist Berlin aus seiner geographischen und politischen Randlage ein Stückchen weiter der Mitte zugerückt. Aber zum "Zentrum der Welt", wie so töricht gesagt wurde; ist es noch weit. Fraglich zudem, ob es überhaupt noch einen Mittelpunkt der Erde geben soll. Der, bekanntlich, ist zu heiß Die Menschheit, die sorgenvoll oder leichtlebig die Oberfläche bevölkert, ist derzeit wohl für die gelassenen und dann doch wieder majestätischen Musikbotschaften besonders empfänglich; zumal wenn sie aus dem magischen Kreis Celibidaches herrühren. Und wenn sie dazu noch einem guten Zweck dienen.
Frieder Reininghaus
Triumphale
Rückkehr eines Verwandelten
Sergiu
Celibidache dirigiert nach 38 Jahren wieder die
Berliner Philharmoniker
Dem Bundespräsidenten ist es zu verdanken, daß Münchens Generalmusikdirektor Sergiu Celibidache nach fast vier Jahrzehnten erstmals wieder ans Pult der Berliner Philharmoniker trat - jenes Orchesters, das er nach Kriegsende mehr als vierhundertmal dirigierte und von dem er 1954 in Verbitterung schied. Weizsäcker hatte ihn zu zwei Benefizkonzerten ins Berliner Schauspielhaus gebeten. Politische und musikalische Prominenz aus ganz Deutschland sowie viele alte Berliner Anhänger feierten den fast 80jährigen mit Standing ovations wie einen Spätheimkehrer - doch es war die Rückkehr eines Verwandelten in seine einstige musikalische Heimat.
Es war, statistisch gesehen der 415. Auftritt am Pult der "Berliner". Sieben schwere Nachkriegsjahre lang waren sie sein Orchester gewesen, das er, damals ein junger genialischer Feuerkopf, zusammengehalten und durch unvergeßliche Aufführungen inspiriert hatte, bis es der alte Chef Wilhelm Furtwängler wieder übernahm.
Während der sechs Proben zu Bruckners 7. Symphonie fiel der Name Furtwängler, so berichten die Musiker, viele Male. Aus dessen und Celibidaches Tagen spielen heute noch drei im Orchester mit. Dazwischen liegen mehr als drei Jahrzehnte der triumphalen Ära Karajan der vom Orchester 1954 einstimmig zu Furtwänglers Nachfolger gekürt wurde: eine bittere Enttäuschung, die Celibidache - damals mit den Philharmonikern schrecklich zerstritten - so enttäuschte, daß bis zum nächsten Auftritt, dem am Dienstag, 38 Jahre verstreichen mußten.
Bonmots von gestern
Diese lange Periode selbstgewählter Abstinenz war nun vorbei und ein bißchen verdrängt: vergessen die vielen maliziösen Ausfälle des rumänischen Maestro über sein Orchester schon im Jahre 1950, so daß ihn damals Furtwängler um Mäßigung bitten mußte; vergessen die schnöde Art, mit der wiederum beim hundertsten Orchesterjubiläum die Celibidache-Periode so gut wie totgeschwiegen wurde; vergessen die vielen Vorwürfe, Furtwängler hätte über ihn ständig schlecht gesprochen und gegen ihn intrigiert; vergessen schließlich auch die spöttische Charakterisierung des Karajan-Orchesters, dies sei ja nichts als ein Ensemble für Kontrabässe und Begleitung. Was gilt ein Bonmot von gestern? Im Berliner Schauspielhaus setzte der Gast aus München das Orchester erst einmal völlig um, verstärkte es auf zwölf Celli und zehn Bässe und zog sie ganz nach vorn an die Rampe; er ließ die Blechbläser die Seiten tauschen und verbrachte viele halbe Stunden mit der Beschwörung der eigenen philharmonischen Vergangenheit. Doch dieses war ein Erinnerungsausflug ins musikalische Vorgestern; denn das Orchester, das er nun, da er es plötzlich selbst leitete, über den grünen Klee lobte, ist das von ihm einst so geschmähte Karajan-Orchester, in dem man sich derzeit nicht ohne Mühen mit Claudio Abbados neuem Arbeitsstil anfreundet.
Die Berliner Philharmoniker sind ein besonders selbstkritisches Orchester, sie spüren genau ihre Meriten und die Grenzen ihrer Konzerte, aber auch hier gelang es Celibidache, die Musiker in ihrer Meinung über seine Arbeitsweise zu polarisieren: "Was wir hier mit Celi jetzt erleben, dagegen ist unsere Aufnahme neuerlich unter Barenboim doch kalter Kaffee", formuliert ein erfahrener Bläser. Ein prominenter Streicher hält dagegen: Der alte Herr hat offenbar überhaupt kein Gefühl mehr dafür, wie er seine eigene Vorstellung in diesem wahnwitzig langsamen Tempo überhaupt noch verwirklichen kann."
Natürlich hat der mit vielen publizistischen Vorschußlorbeeren bedachte Maestro sogar die ausgefuchsten Berliner Philharmoniker beeindruckt, und sie fanden sich mit seinem ehern-zurückhaltenden Altersstil durchaus zurecht. Über seine Bruckner-Interpretationen Münchner Musikfreunden Neues berichten zu wollen, mag sich fast erübrigen. Ähnlich wie bei Bruckners Fünfter bei der Gasteig Eröffnung oder der Fünften von Schostakowitsch etwa entsteht bei Celibidache ein völlig anders Musikstück. Am Dienstagabend durchmaß er die Partitur in genau 87 Minuten (Pausen zwischen den Sätzen nicht gerechnet), länger als jeder andere alte ehrwürdige, von Celibidache verachtete Kollege. Sein vielbeschworenes Idol Furtwängler, der ja auch kein Langweiler war, hat zwei Platteneinspielungen hinterlassen, die zu den geschwindesten des langen brucknerschen Werkes gehören: nämliche beide Male exakt 62(!) Minuten lang. Nun, Musik vollzieht sich in der Zeit, und man kann über die verschiedenen Tempi durchaus streiten; bei 25 Minuten Unterschied innerhalb einer Symphonie freilich nur noch staunen.
Philharmoniker aus Berlin bezeugten mehrfach, die Generalprobe, nicht gar so lähmend, wäre wirklich beeindruckend gewesen, doch in der Aufführung hätte - vor allem in den ersten beiden Sätzen, die in einer vollen Stunde vorüberkrochen - die Spannung einfach nicht mehr gehalten. Wie recht sie hatten.
Sergiu Celibidache hat für seine Darbietungen von solchen extremen Alternativen bekanntlich ganze philosophische Argumentationsgebäude errichtet, aus denen die meisten Unwissenden verbannt bleiben. Doch auch Anton Bruckner blieb an diesem Abend mit seiner Musik bisweilen auf der Strecke: Das einleitende Allegro schleppte sich von Halbtakt zu Halbtakt; Steigerungen wurde ein so langer Anlauf zuteil, daß sich Spannungen bis zur Langweile neutralisierten; im Adagio erwuchs beispielsweise einer arabesken Begleitfigur plötzlich so viel Eigengewicht zu, daß der Bläsersatz zur Bedeutungslosigkeit verkümmerte. Die Bläser, übrigens nicht ohne Itonationsprobleme, bewiesen leuchtende Kraft, und die Streicher legten sich ins Zeug, solange die Bogenlänge reichte; das Engagement war allenthalben zu spüren, Scherzo und Finale, vom Orchester leicht, aber spürbar vorangetrieben, blieben, zumal bei der dröhnenden Schauspielhaus Akustik, an Wirkung nichts schuldig.
Wie gesagt, Ovationen, zu denen der Bundespräsident zu Konzertbeginn auch noch hilfswillig animiert hatte. Aber der "Celi", den die Berliner nach dem Krieg jahrelang erlebt hatten, war es nie und nimmermehr. Der brillante Feuerkopf
ließ seinen eisern lähmenden Willen über Bruckners Musik hinabsinken. Und so oft in diesen Tagen der Name Furtwängler als der eines künstlerischen Ahnherrn beschworen wurde, war dies lästerlich: Niemals in seinem langen Dirigentenleben hat dieser geniale Mann Bruckners Symphonien gewissermaßen im Rollstuhl vorgeführt. Celibidaches Bewunderer haben längst aufgehört zu fragen, warum er dies oder das tut, sondern verbannen jeglichen Zweifel daran, nur weil er es tut. Die Freude, den Gast aus München wiederzusehen, überstrahlte den Eindruck: ein Fremder war heimgekommen nach Berlin.
Albrecht Roeseler
Ein
Eidbruch wird zum Ereignis
Sergiu
Celibidache und die Berliner Philharmoniker
Ein "wirkliches Fest", so Bundespräsident Richard von Weizsäcker in seiner an den "verehrten Meister" adressierten Einladung, könnte es werden, wenn dieser sich nach achtunddreißig Jahren entschlösse, endlich wieder einmal den Taktstock vor dem Berliner Philharmonischen Orchester zu heben: "ein Fest für mich, für das Orchester, für Berlin und die ganze musikalische Welt". Sergiu Celibidache mochte die Bitte einer so hochrangigen Persönlichkeit, wie der Bundespräsident nun einmal eine ist, nicht abschlagen; und so begann alsbald, wenn nicht die ganze Welt, so doch das ganze musikalische Berlin einem "Benefizkonzert des Bundespräsidenten zugunsten von Kinderheimen in Rumänien" entgegenzubangen, und damit einer Veranstaltung, die das zu werden versprach, was im banalen Sprachgebrauch gern als "ereignishaft" bezeichnet wird.
Das Ereignishafte wurde jedoch in der Tat zum Ereignis, und zwar im Berliner Schauspielhaus. Zunächst trat der Bundespräsident ans Dirigentenpult und überraschte das Publikum mit der launigen Bemerkung, daß er nicht den Taktstock, sondern das Wort ergreifen werde. Er erinnerte die älteren Zuhörer an die Zeit, da der junge Celibidache Mitte 1945 sozusagen aus dem Stand die Leitung des Berliner Philharmonischen Orchesters übernahm und als Statthalter des mit Entnazifizierungsproblemen befaßten Wilhelm Furtwängler dem durch den Krieg dezimierten und nur langsam sich regenerierenden Berliner Philharmonischen Orchester in verblüffend kurzer Zeit den alten Rang antrainierte. Als Furtwängler nach seiner Entnazifizierung im Jahre 1952 seine Chefdirigentenposition wieder übernehmen durfte, übernahm er das international respektierte Eliteorchester, das die Berliner Philharmoniker noch in den ersten Kriegsjahren gewesen waren. "Celi", der feuerköpfige Perfektionist, der seine geistige Heimat im Zen-Buddhismus gefunden hatte, war unterdessen zur Kultfigur vor allem der jüngeren Musikfreunde avanciert.
Um so größer seine Enttäuschung und die seiner Anhänger, als die philharmonischen Musiker nach Furtwänglers Tod im Jahre 1954 nicht ihn, sondern Herbert von Karajan zu ihrem neuen Chefdirigenten wählten: Die Unerbittlichkeit seiner Probenarbeit hatte ihm Gegner vor allem unter den privilegierten Orchestervorständen und den älteren Orchestermitgliedern geschaffen. Unter der Leitung des medienbewußten Karajan versprachen sie sich einen einträglicheren Umgang mit den Vermarktungsstrategen in den Rundfunkanstalten und Schallplattenkonzernen, als in der Musikskeptiker Celibidache hätte gewährleisten können. Daß ihre Rechnung über alles Erwarten gut aufging, wenn auch auf Kosten Celibidaches, hat sich unterdessen herumgesprochen. Celibidache beantwortete die Brüskierung mit einem Schwur: Nie wieder, ließ er die Musikwelt wissen, werde er das Berliner Philharmonische Orchester dirigieren. Das Orchester kassierte Tantiemen und bemühte sich, die lästige Sache zu vergessen.
Celibidache aber blieb die Kultfigur, die er in Berlin geworden war. Er blieb sie als Chefdirigent des Schwedischen Rundfunk-Symphonie-Orchesters, er blieb sie als Chefdirigent des Süddeutschen Rundfunks und er blieb sie auch in München, wo er seit 1979 als Chefdirigent der dortigen Philharmoniker residiert. Daß er auch in Berlin nichts von. seinem Nimbus eingebüßt hat, zeigte sich, als er nach einem Shakehands mit dem Bundespräsidenten ans Pult des Orchesters trat, das ihm, einst mehr zu verdanken hatte, als es in der finanziell überaus einträglichen Ära Karajan wahrhaben wollte. Als er im Schauspielhaus nach einer wunderbar ausgehörten, Maßstäbe neu setzenden Wiedergabe von Bruckners siebter Symphonie langsam den Taktstock sinken ließ, feierte ihn das ganze Publikum, die Weizsäckers inbegriffen, mit standing ovations.
Die aber waren verdient, denn Celibidaches Eidbruch hatte sich ausgezahlt - für ihn, für die Musiker, die er in sechs Intensivproben zu ihren besten Möglichkeiten inspiriert hatte, und für Bruckner, dessen Siebte man in Berlin seit Jahrzehnten nicht mehr ähnlich souverän und gelassen disponiert und in einer ähnlich subtilen Ausgestaltung der Details gehört hat. Der Wortbruch wurde immer wieder in dem ins Mystische changierenden Klang des Orchesters illuminiert. Vor allem bei der Wiedergabe des Adagios und der Durchführung in den Ecksätzen musizierten Celibidache und das Orchester, das für einige Tage wieder "sein" Orchester geworden an den Grenzen jenes Bereichs, in dem das Intendierte, Beabsichtigte und Gewollte sozusagen in einem "Seienden" aufgeht. Nach eineinhalb musikalisch erfüllten Stunden applaudierten alle allen - der Dirigent dem Orchester, das Orchester dem Dirigenten und das enthusiasmierte Publikum allen beiden.
Die Versöhnung zwischen dem fast achtzigjährigen Dirigenten und den Berliner Philharmonikern hätte sich schwerlich kompetenter und bewegender inszenieren lassen.
Hellmut Kotschenreuther - Stuttgarter Zeitung
Der
triumphierende Heimkehrer
Sergiu
Celibidache dirigiert das Berliner Philharmonische
Orchester
Wo soviel Rührung der Kunst begegnet wie in diesem Konzert und, ins Weite gesehen, solche geschichtlich singuläre Dimension, da ist Außermusikalisches von der tatsächlich erklingenden Musik nur schwer zu trennen: Sergiu Celibidache dirigiert nach über 37 Jahren zum ersten Mal wieder das Berliner Philharmonische Orchester.
Die Herzenssache, die der Zuhörer, der beteiligte Musiker auf dem Podium aus dem Ereignis machen, hat wiederum mit dem Gelingen selbst unmittelbar zu tun. Die Situation im seit Wochen ausverkauften Schauspielhaus klärt sich von Beginn an dahin, daß das musikalisch Außerordentliche gespannte Anteilnahme und Resonanz findet. Veranstaltet wird der Abend mit der siebenten Symphonie von Anton Bruckner, die bei Celibidache eine Dauer von eineinhalb Stunden erzielt, als "Benefizkonzert des Bundespräsidenten zugunsten von Kinderheimen in Rumänien". Dirigent und Orchester haben sich ohne Entgelt zur Verfügung gestellt, ebenso die Konzertdirektion Hans Adler, die den Kartenvertrieb (Höchstpreis 180 DM) besorgt hat. 410 000 DM kamen so und durch Spenden zusammen.
Richard von Weizsäcker steht an der Spitze der Überredungskünstler, denen gelungen ist, was Jahrzehnte als unmöglich galt: Celibidache zum Pult der Berliner Philharmoniker zurückzuholen. In einem improvisierten herzlichen Willkommensgruß weist er darauf hin, daß dies Orchester einmal Celibidaches Orchester gewesen sei, "in dessen Mitte er gelebt hat". Dann brandet der Applaus, weil der Maestro das Podium betritt.
Ältere Konzertgänger erinnern sich und jüngere kennen die Legende, daß der rumänische Student der Berliner Musikhochschule, 1946 nach dem Tod Leo Borchards von den Philharmonikern zu ihrem Leiter gewählt, das Orchester Nikischs und Furtwänglers zwar als ein Anfänger, aber wie ein Vollendeter betreute. Beethoven, Schubert, Mendelssohn, Tschaikowsky, Bartók, Strawinsky, zumal die französischen Impressionisten glänzten unter der jungen Podiumsmajestät. Manch einer, der dabei war, fand seine Eindrücke später nicht mehr überboten. Gerühmt wird schon in den frühen Jahren der Klangsinn Celibidaches, das Leuchten und Funkeln seiner Orchesterpalette.
1952 hatte Celibidache für den Chefdirigenten Wilhelm Furtwängler, während dessen Entnazifizierungsfrist er am philharmonischen Pult als Statthalter fungierte, das Amt wieder freigemacht - einer späteren Äußerung zufolge in dem gewachsenen Stolz, ihm zu sagen "Herr Doktor, hier ist Ihr Orchester". Celibidache stimmte vorher schon mit den Musikern darin überein, Furtwängler so schnell wie möglich zurückzugewinnen. Es gab nach 1947 eine Zeit, in der die beiden Dirigenten mit den wichtigsten Aufgaben alternierten, so auch auf einer England - Tournee 1948. Die Beziehung zwischen ihnen erkaltete. Celibidaches undiplomatisches Temperament machte ihm Feinde. Nach Furtwänglers Tod 1954 wählte das Orchester Herbert von Karajan zu seinem Nachfolger, der 1955 vor der Öffentlichkeit "mit tausend Freuden" annahm.
Die begreifliche Verbitterung Celibidaches und daß er die Berliner Philharmoniker fortan mied, vielleicht nicht ohne geheimes Interesse an ihrem Werdegang, kann nicht auslöschen, daß die Musikgeschichte der Stadt eine Epoche Celibidache zu verzeichnen hat. Sie umspannt die Zeit zwischen den Eckpunkten des ersten Konzerts im August 1945 und des letzten am 29./30. November 1954. Celibidache führte damals im Saal der Musikhochschule mit den Philharmonikern Werke seines Lehrers Heinz Tiessen, Béla Bartóks und einen Ravel auf, der als ein "wahres Hexenkunststück an Klangspielerei" empfunden wurde.
Der Schwierige und Unzeitgemäße, der um der Musik willen in seinen Probenforderungen Verstiegene, der Bescheidene in Anbetracht der Wahl seiner musikalischen Partner, etwa des schwedischen Symphonieorchesters Stockholm, dessen Leitung er Anfang der sechziger Jahre übernahm, der Verächter der Tonträgervermarktung und Apologet einer lebendigen Musik hat ein mehr als geneigtes Publikum am Ort seines frühen Ruhms immer behalten. Wenn er mit den auswärtigen Orchestern kam, meist als Festwochengast, war es zur Stelle. Seit 1979 ist Celibidache Generalmusikdirektor der Stadt München, und die Münchner Philharmoniker wissen ihrem Chef Dank für einen erstaunlichen Aufstieg. Es ergab sich die Ära eines Spitzenorchesters ohne Schallplattenexistenz, mit Schwarzpressungen natürlich. Jüngst läßt der Maestro Live-Mitschnitte auf Video-CD zu, er hat somit ein beachtliches Stück technischen Zeitalters übersprungen.
Im Berliner Philharmonischen Orchester heute sind noch sieben Musiker aktiv, die Celibidaches künstlerische Jugendreife in der eigenen Jugendzeit musizierend miterlebt haben. Nicht alle sitzen auf dem Podium bei diesem Doppelkonzert an zwei Abenden. Einige aber, darunter Rainer Zepperitz, dem der strenge Maestro sogar eine der ausnahmsweise und ihm zuliebe gewährten sechs Proben für ein nicht unvertrautes Werk erlassen hat, haben den menschlichen Kontakt nie abreißen lassen. Dienstfreie Philharmoniker und solche im Ruhestand finden sich neben anderen Berliner Musikern zur Generalprobe ein; Celibidache äußert sich bewegt über die Wiederbegegnungen und die Arbeitsbereitschaft des Orchesters im Sinn seiner Intentionen, eine Ansprache des Dankes. Es hat eine Annäherung mit Gesprächen über den Tag hinaus stattgefunden.
Hellmut Stern vom Orchestervorstand zeigt sich von einer Begeisterung erfüllt, die zu differenzieren weiß. Seit er Celibidache in Israel 1953 kennengelernt hat, mit einem französischen Programm, ist ihm dieser Zauberklang unvergeßlich geblieben: "Das hat richtig geduftet". Ebenso setze für ihn der nun erworbene Bruckner Klang Maßstäbe. Einhellig wird gesagt, daß die Aufmerksamkeit des Orchesters während der Proben - "mucksmäuschenstill" - unübertrefflich gewesen sei. Offenbar hat der 79jährige Dirigent gerade auch die Jüngeren in Bann geschlagen. Für den Konzertmeister Daniel Stabrawa, dessen Engagement in dieser Sache allein schon optisch eine Freude ist, gilt "selbstverständlich" der Wunsch, erneut mit Celibidache zusammenzukommen, weil die Arbeit mit ihm für einen Musiker nur Gewinn bringen könne. So die Stimmung der Generalprobe, eine denkwürdige Mischung aus Spannung und Gelöstheit. Die Philharmoniker überreichen dem Dirigenten als Geschenk eine Beethoven Partitur.
Sergiu Celibidaches Bruckner, ein Hauptgebiet seines Musikerdaseins, das er sich nach der Berliner Zeit zum geistigen Besitz gemacht hat, ist dennoch wegen der Gastspiele aus München für Berlin nicht neu. Der Bereich des absolut Musikalischen wird nie verlassen. Die subjektive Neigung zum Verweilen, die langsamen Tempi bewirken, daß ein Pianissimo der Streicher und des Fagotts, folgend auf ein Piano, werktreu - das strittige Wort erhält neuen Wert - zur Sensation wird. Das naturleichte Vibrato, ein gemeinsam immaterielles Tremolo tendieren zur Schwerelosigkeit.
Dennoch lehrt Celibidaches Interpretation der Siebenten die unterschiedlichen Arten, ein Tremolo zu spielen. Bei den Steigerungen zum Fortissimo dominieren die auskomponierten Register, nirgends Nervosität des Anheizens. Zur Erfahrung wird, daß Schlichtheit dem Erhabenen näher ist als ein polierter Sound. Sehr selten sind bei dieser musikalischen Neubegegnung kleine Unebenheiten. Der Klagegesang der Tuben "zum Andenken an den Hochseligen, heiß geliebten unsterblichen Meister" Richard Wagner hat als Coda des Adagios nach dem sehr untheatralischen Beckenschlag vertiefende Aura. Scheinbar kunstlos brilliert eine Kunst des Zurücknehmens. Die Cellogruppe ist mit aller Augen auf den Dirigenten gerichtet, wenn sie ihre Melodieführung in seinem Sinn wahrnimmt.
Da die Berliner Philharmoniker diesen Bruckner-Klang, in dem die Dynamik Primärkategorie ist, mit großem Einsatz verwirklicht haben, lenkt der Dirigent Sonderbeifall auf alle Orchestersolisten, darunter als Gast der Oboist Günther Passin, und auf die einzelnen Streicher- und Bläsergruppen nach und nach. Das Orchester applaudiert seinem Heimkehrer, der noch lange allein umjubelt wird.
Gestern bestätigte Intendant Ulrich Meyer-Schoellkopf, wie sehr "alle" erhofften, daß Sergiu Celibidache wiederkäme zu Konzerten mit dem Berliner Philharmonischen Orchester.
Sybill Mahlke
Vorwort zu den beiden Benefizkonzerten von Bundespräsident Richard von Weizäcker